|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
Version 100828 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
Version 100828 |
|||||||
Kopieranleitung,
Hinweise und Haftungsausschluß am Seitenende.
|
Top mit
Inhaltsverzeichnis >> |
Abriss-#;
Abscher-#;
AO-Klassifikation,
Grundlagenn
Biegungs-#;
Bruchformen
einfache
#,
Epiphysen-#
(Aitken, Salter-Harris, Rang und Ogden)
Ermüdungs-#;
Grünholz-#
Keil-#
komplexe #
Luxations-#;
mehrfragmentäre
#
offene
#
pathologische
#
periprothetische # (Bethea, Mont-Maar,
Johansson,
Cooke und Newman, Vancouver, Hockertz)
Pseudarthrose
Trümmer-#
Wulst-#
Heilungsphasen bei #,
Heilungszeiten von ##,
Komplikationen bei #-Heilung,
verzögerte Heilung
Sudeck-Syndrom
- immer auf
Röntgen in 2 Ebenen bestehen!
- Nachbargelenk in die Abbildung einbeziehen
frakturverdächtig
sind:
- Weichteilschwellung
- Verlagerung oder Auslöschung von Fettstreifen
- Periostveränderungen
- Gelenkerguß
- Fett-/ Flüssigkeitsspiegel
- veränderte Kortikalis- Kontur
- unregelmäßige Metaphysenkanten
Beschreibung der Fraktur (#):
- Ort und Ausdehnung
- Richtung der Bruchlinie
- Stellung der Fragmente zueinander (distales zu proximalem)
- Vorliegen von Einstauchung, Depression,
Kompression
- Begleitanomalien
- Beteiligung der Epiphysenfuge
- Typ
|
Kortikalisunter- |
Fraktur! |
|
Gelenkbeteiligung: |
Arthrosegefahr! |
|
einfache #
oder |
wichtig für OP-Planung und Verlauf |
|
Belastungs- |
Schemata
nach |
|
Ausmaß
der |
wichtig
für Prognose und |
|
Sklerosezonen, Kallusbildung |
ältere # |
|
spitz und
scharf |
frische # |
|
persistierende # -Spalten? |
Pseudarthrose- |
|
traumatische
oder |
tumoröse Knochen- infiltration |
A: Dislocatio ad
latus
B: ad axim
C: ad peripheriam
D: ad longitudinem cum contractione
E: a.l. cum distractione
F: a.l. cum impressione
morphologische Begriffe:
einfache #: zirkuläre
Kontinuitätsunterbrechung der Metaphyse oder Diaphyse,
spiralig, schräg oder quer; einzelne Unterbrechung einer
Gelenkfläche;
Trümmer-#: > 6
Teile, sonst Stück-# - soll nach AO
nicht mehr gebraucht werden!
Besser:
mehrfragmentäre
#: ein
oder mehrere vollständig separierte Zwischenstücke
Keil-# (gilt für Meta-/Diaphysen-#): # mit
einem oder
mehreren Zwischenstücken. Nach Reposition haben die
Hauptfragmente Kontakt miteinander
komplexe # (gilt für Meta-/Diaphysen-#):
ein oder mehrere
Zwischenstücke. Nach Reposition haben die proximalen und
distalen Hauptfragmente keinen Kontakt miteinander.
Gelenkspaltbreiten:
|
Akromioklavikulargelenk |
2-4 mm |
|
Ellbogengelenk |
3 mm |
|
Hüftgelenk |
5 mm |
|
Iliosakralgelenke |
3 mm |
|
Interkarpalgelenke |
2 mm |
|
Intertarsalgelenke |
2 mm |
|
Intervertebralraum |
5 mm |
|
Kiefergelenk |
2 mm |
|
Kniegelenk |
5 mm |
|
Metakarpophalangialgelenk |
2 mm |
|
Metatarsalgenk |
2 mm |
|
OSG |
4 mm |
|
Radiokarpalgelenk |
2 mm |
|
Schultergelenk |
4 mm |
|
Sternoklavikulargelenk |
4 mm |
|
Symphyse |
3-6 mm |
|
- Riß ventr. Ligament |
15 mm |
|
- ventr.+ dorsale Ligamente |
40 mm |
|
Tarsometatarsalgelenk |
2 mm |
|
Wirbelgelenke |
2 mm |
|
Zehengelenke |
2 mm |
Flachwirbel in der BWS.
1.
Schritt:
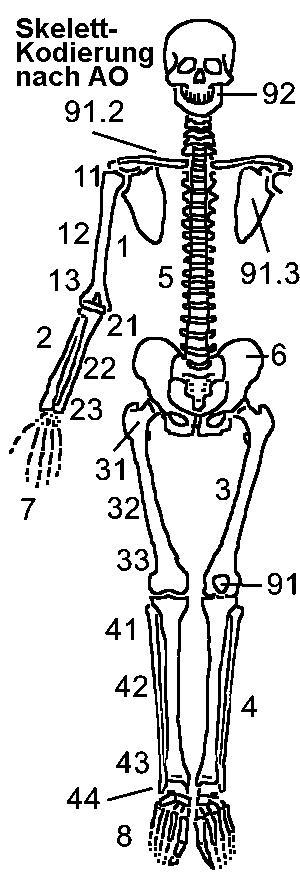
lange Röhrenknochen erhalten eine zusätzliche Ziffer:
1: proximal; 2:
diaphysär; 3: distal;
4: malleolär;
|
Schaft-# |
Gelenk-# |
WK-# |
|
|
A |
Kontakt der |
extra- |
Impres- |
|
B |
Keil-# |
partielle |
Distrak- |
|
C |
komplexe # |
vollständ. |
Impres- |
4. und 5.
Schritt:
Zuteilung nach Subgruppen bzw. Qualifizierungen.
Biegungs-#
An der Konkavseite
der Biegung kommt
es zur Stauchung mit Ausbrechen eines Biegungskeils. Auf der
Konvexseite reisst der Knochen durch Zugspannung.
Ergänzung
nach Rang und
Ogden:
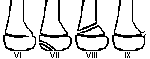
Typ 6:
randständige
Verletzung des Perichondriums mit Fesselung der Epiphysenfuge
(periphere Brückenbildung)
Typ 7:
Epiphysen-# (chondrale
oder osteokartilaginäre # ohne Beteiligung der
Epiphysenfuge)
Typ 8:
Metaphysäre # (ohne
Beteiligung der Epiphysenfuge)
Typ 9: Abrissverletzung des Periosts (ohne
knöcherne
Beteiligung, die Epiphysenfuge überschreitend)
Aitken-I-Fraktur;
Salter-Harris
II
Epiphysiolyse.
In der
seitlichen Projektion ist die Epiphyse nach dorsal verlagert.
Salter-Harris I.
Salter-Harris Typ 5. Zunächst keine Fraktur erkennbar. Nach 6 Wo. ist eine Sklerosierrung der fugennahen Kompakta zu erkennen.
Ermüdungs-#
bei langdauerndem
Missverhältnis
zwischen Belastung und Anpassungsfähigkeit des Knochens
(Metatarsale II und III (Marschfraktur) oder proximaler
Femur)
Grünholz-#:
kindliche
# ohne Dislokation und
mit intakter Kortikalis auf einer Seite (Stabilisierung durch
Periostschlauch), an der konvexen Seite vollständig
frakturiert. Kaum Achsabweichung. Typische Lokalisation: distaler
Radius.
Keil-#
(gilt für
Meta-/Diaphysen-#): # mit
einem oder mehreren Zwischenstücken. Nach Reposition haben die
Hauptfragmente Kontakt miteinander.
Komplexe
#
(gilt für Meta-/Diaphysen-#): ein oder mehrere
Zwischenstücke. Nach Reposition haben die proximalen und
distalen Hauptfragmente keinen Kontakt miteinander.
periprothetische # bei TEP (Bethea, Mont-Maar, Johansson, Cooke und Newman, Vancouver, Hockertz, siehe bei Femur bzw Knie)
Pseudarthrose
("non-union") nach 6-8 Monaten):
Trümmer-#
> 6 Teile,
sonst Stück-# -
soll nach AO nicht mehr gebraucht werden!
Besser:
mehrfragmentäre #: eines oder mehrere vollständig
separierte Zwischenstücke.
Wulst-#: Stauchung
in Längsachse
in der Metaphyse des langen Röhrenknochens. Die
Verwerfung
der Kortikalis ist als Wulst sichtbar. Daneben besteht eine
querverlaufende Spongiosaverdichtung.
|
Becken |
4-10 Wochen |
|
Femurhals |
12-20 Wo- |
|
Femurschaft |
12-16 Wo. |
|
Fibula allein |
4-6 Wochen |
|
Finger |
3-4 Wochen |
|
Humerus: |
|
|
- infratuberkulär |
4-5 Wochen |
|
- Schaft |
6-8 Wochen |
|
- suprakondylär |
4-6 Wochen |
|
Knöchel |
6-12 Wochen |
|
Metakarpalia |
4 Wochen |
|
Metatarsalia |
4-6 Wochen |
|
Navikulare |
12-16 Wo. |
|
Olekranon |
3-4 Wochen |
|
Patella |
4 Wochen |
|
Radius |
3-4 Wochen |
|
Radius und Ulna |
8-10 Wochen |
|
Radiusköpfchen |
3-4 Wochen |
|
Tibia allein |
8-14 Wochen |
|
Unterschenkel, disloziert |
12-16 Wo. |
|
Wirbelkörper |
12-16 Wo. |
|
Zehenglieder |
2-3 Wochen |
Verzögerte
Heilung: keine
Durchbauung sondern abdeckelung der Frakturflächen.
Sudeck-Syndrom
(Algodystrophie):
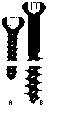 Kortikalisschrauben
Kortikalisschrauben|
|
95º Winkelplatte, Kondylenplatte weitere
Typen: |
|
|
|
|
|
Proximaler Verriegelungs-Nagel (PFN, Gamma- Nagel) H:
Hüftgleit- Schraube (Antirotations- Schraube) |
|
|
|
|
Marknagel distal besteht ein Loch für statische Verriegelung und ein ovales Loch für eine dynamische Veriegelung. |
|
Top mit Inhaltsverzeichnis > Definitionen > Schädel > Halswirbelsäule > |
|
Test und Reaktion: |
Pkt. |
|
Augen öffnen |
|
|
fehlt |
1 |
|
auf Schmerzreiz |
2 |
|
auf akustische Stimuli |
3 |
|
spontan |
4 |
|
sprachliche Reaktion |
|
|
keine |
1 |
|
unartikulierte Laute |
2 |
|
einzelne Wörter |
3 |
|
verwirrt |
4 |
|
orientiert |
5 |
|
motorische Reaktion |
|
|
keine Bewegungen |
1 |
|
Extensionshaltung |
2 |
|
Flexionshaltung |
3 |
|
zieht Extremität zurück |
4 |
|
lokalisiert Stimulus |
5 |
|
befolgt Aufforderung |
6 |
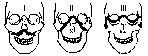
Mittelgesichts-Frakturen können in 2 CT-Schichtebenen erfaßt werden, in denen die Leitstrukturen liegen: in der unteren Schicht die Kieferhöhlenwände, in der oberen Schicht nasoethmoidaler Block und laterale Orbitawände.
|
Top mit Inhaltsverzeichnis >> Schädel > Halswirbelsäule > Brustwirbelsäule > |
Kondylen-# nach Anderson und Montisano
Typ I: Kondylen-Impaktierung Typ
II: Impaktierung
mit Basis- oder Kalotten-# Typ
III: Kondylen-Abscherung
Instabilitätszeichen kraniozervikaler
Übergang:
Dens-Basion-Distanz >4-5 mm Differenz bei
Funktionsaufnahmen >1 mm Dens-Atlas-Distanz >3 mm Atlas-Überhang
re+li >7mm prävertebraler
Weichteilschatten <7 mm
Höhe C2
Obere
HWS
Atlas-# nach Lvine und Edwards
Typ I: Berstung
(Jefferson-#) Typ
II: # hinterer
Bogen Typ
III: Trümmer-# Typ
IV: # vorderer
Bogen Typ V: # Massa
lateralis Typ
VI: # Proc
transversum Typ
VII: # Tuberculum
inferior
|
Typ I |
# vorderer Bogen, meist mit Dens-# |
|
Typ II |
# hinterer Bogen, am häufigsten |
|
Typ
III |
Jefferson-#:
Atlasberstungs-# INSTABIL
|
|
Typ IV |
# Massa lateralis |
|
Typ V |
# Proc transversum |
|
Typ I: |
einfache Rotation um den Dens ohne Ventralverlagerung; Lig. transversum intakt |
|
Typ II: |
Rotation um die gegenüberliegende Facette mit Ventralverlagerung um mindestens 3,5 mm. |
|
Typ III: |
Rotation
mit Ventralverlagerung um > 5 mm; beide Gelenke sind nach
ventral luxiert |
|
Typ IV: |
seltene dorsale Luxation |
|
Typ V: |
(Levine und Edwards) massive Dislokation |
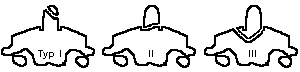
 Dens-Dislokation:
Dens-Dislokation: teardrop-#:
teardrop-#:
|
Top mit Inhaltsverzeichnis >> Halswirbelsäule > Brustwirbelsäule > Lendenwirbelsäule > |
AO-Klassifikation
Charakteristika der AO-Frakturtypen B und C
Instabilitätszeichen
3-Säulenmodell nach Denis
Instabilitätszeichen an den Säulen
DD
WK-#, Trauma,
Osteoporose
AO-Klassifikation
der
Brust- und Lenden-WS
(ausführlichere AO-Klassifikation siehe www.jend.de)
Die Wirbelsäule hat die Bezeichnung "5"; sie erhält 2
weitere Ziffern, die mit einem Punkt getrennt werden: die Ziffern 1,
2 bzw. 3 für HWS, BWS bzw. LWS und nach dem Punkt die Nummer
des
Wirbelkörpers.
Die Beschreibung einer Impressions-# des 11.BWK beginnt demnach mit: "52.11 A...".
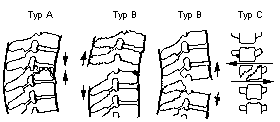
|
|
A: vordere
Säule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ballonierte Bandscheibe |
|
|
|
|
ap WK-Verbreiterung |
|
|
|
|
nur 1 WK betroffen |
|
|
|
|
Endplatten sklerosiert |
|
|
|
|
Spondylose |
|
|
|
|
Spinalkanaleinengung |
|
|
|
|
Kyphoseknick in Höhe Bandscheibe |
|
|
|
|
Top mit Inhaltsverzeichnis >> Brustwirbelsäule > Lendenwirbelsäule > Thorax |
Instabilitätszeichen LWS
Instabilitätszeichen lumbosakraler Übergang
Os
sacrum-# nach
Denis
Instabilitätszeichen
LWS:
- - Kompression Vorder- und Hinterkante,
- - # oder Fehlstellung der posterioren Elemente,
- - Hinterkantenkompression,
- - kyphotische Abknickung > 11º,
- - Flexion: > 16% Translation,
- - Extension: > 12% Translation
Instabilitätszeichen lumbosakraler Übergang:
- - Beugung: > 25% des WK-Sagittaldurchmessers
- - Überstreckung: > 12%
- - relative Kyphosierung > 19º
Kompressions-#der Lendenwirbeldeckplatte. Abriss der
oberen
Vorderkante. Verschiebung des Wirbelkörpers nach dorsal.
Instabilität.
Os sacrum-# nach Denis
Os
sacrum-#
Top mit
Inhaltsverzeichnis >> Lendenwirbelsäule > Thorax
> Abdomen
Thorax
Verschattungsmuster im Thoraxbild
Ergussnachweis
Rippenserien-#, Rippenstück-#
Sternum-#
Pneumatozele
Pneumothorax
Spannungspneumothorax
Tracheobronchiale Ruptur
Aortenruptur
Verschattungsmuster im Thoraxbild:
|
Top mit Inhaltsverzeichnis >> Thorax > Abdomen > Becken |
Lebertrauma
Milztrauma
Nierentrauma
|
Top mit Inhaltsverzeichnis >> Abdomen > Becken > Hüfte und Femur |
Beckenaufnahme a.-p.
Ala- und Obturator-Aufnahmen
Becken-, Beckenring-#, AO-Klassifikation
Azetabulum-# nach Judet und Latournel, Beckenpfeiler
Malgaigne-#, Dashboard-#,
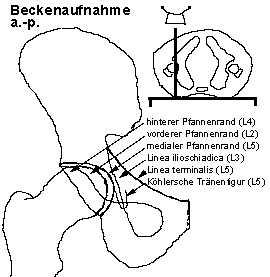
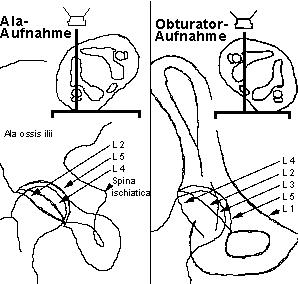
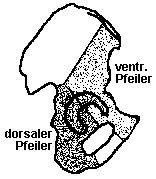
|
|
|
|
|
|
|
|
transazetabulärer Querbruch (trans-tektale, juxta-tektale oder infra-tektale) |
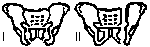
Top mit
Inhaltsverzeichnis >> Becken >
Hüfte und Femur > Knie >
CCD-Winkel, Antetorsions- Winkel
Hüftluxation,
Schenkelhals-#
Varus-, Valgus-Fehlstellungen
AO-Klassifikation proximale Femur-#
Pipkin-#
Pauwels-#,
Garden-Index
Garden #-Typen
Periprothetische # bei TEP (Bethea, Mont-Maar, Johansson, Cooke und Newman, Vancouver, Hockertz)
Knochenkerne und Synostosierung am Becken
Intertrochantere # (Boyd-Griffin)
subtrochantere # (Fielding, Zickel)
Femurschaft-#
AO-Klassifikation Femurschaft-#
distale Femur-#
AO-Klassifikation distale Femur-#
Periprothetische # bei Knie-TEP
 CCD-Winkel
CCD-Winkel 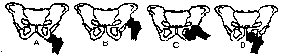
 Schenkelhals- #:
Schenkelhals- #:AO-Klassifikation
proximaler Femur (AO 31A -C) (ausführlichere
AO-Klassifikation siehe www.jend.de)
Endoprothesen (TEP)-Beurteilung:
Kontrollintervalle nach Implantation 1, 3, 5 und 10 Jahre
Hilfslinien zur Beurteilung einer Pfannenmigration:
Implantat-Lockerungszeichen:
1. Sichere Zeichen:
2. Unsichere Zeichen:
bei zementfreiem Implantat:
- Progrediente Lysen und Knochendefekte
normal bei zementfreiem Implantat sind:
TEP-Infektion
Abrieb
Klassifikation nach Bethea
A:
Prothesenspitze und distal der Spitze
B: im Prothesenschaftbereich
C: Mehrfragment- und Trümmer-##
proximal
der
Schaftspitze
Klassifikation nach Mont und Maar:
Typ
1: trochanternahe
Typ 2: im Bereich des Prothesenschaftes
Typ 3: im Bereich der Prothesensoitze
Typ 4: distal der Prothesenspitze
Typ 5: Trümmer-##, nicht nur im
Prothesenbereich,
sondern auch distal davon
Klassifikation nach Johansson:
|
Typ |
#-Lokalisation |
Subtyp |
|
A |
Regio trochantria |
Ag:
Trochanter major |
|
B |
distal des Troch.major bis zur Region der Prothesenspitze |
B
1: stabile Prothese |
|
C |
weit unterhalb des Prothesenschaftes |
ausgewanderte
Pfanne links (Prothesenlockerung)
intertrochantere #
subtrochantere #
|
|
Fielding Klassifikation: I: Höhe Trochanteer minor II: bis 2,5 cm unterhalb Tr.minor III: 2,5-5,0 cm unter Tr. minor |
Zickel Klassifikation
|
|
Typ I: kurze, lineare Schräg-#, evtl mit Biegungskeil Typ II: lange, lineare Schräg-#, evtl mit Biegungskeil Typ III: hohe oder tiefe Quer-# |
Femurschaft-#:
ab 10 cm distal des Trochanter minor
AO-Klassifikation der Femurschaft-#
(32) (ausführlichere AO-Klassifikation
siehe
www.jend.de)
|
Top mit Inhaltsverzeichnis >> Hüfte und Femur > Knie > Unterschenkel > |
Grad I
und II:
fleckige und streifige Signalanhebung (kann bei älteren
Patienten auch die Oberfläche erreichen, wie Grad III) (A)
Grad III:
Linie erreicht eine oder beide Oberflächen.
Horizontalriß, kannneben das Tibiaplateau luxieren (B)
Grad IV:
Longitudinalriß, oft traumatisch (C). Langer
Longitudinalriß (Korbhenkel), kann sich nach medial verlagern
(D). Radiale Risse; setzen sich manchmal longitudinal fort (Papageien-
Schnabel) (E).
Grad V:
diffuse Signalanhebung.
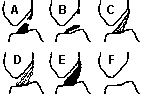
durch Druck auf
ventrale Tibia bei gebeugtem Knie (z.B. Dashboard-Injury), selten bei
Hyperextension.
Begleitverletzungen:
Kontusionsherde in anteriorer Tibiakonsole und im lateralen
Femurkondylus
Kollateralbandverletzungen (MRT):
Osteochondrale
Sleeve-# bei Jugendlichen
|
|
|
Patellarsehnenruptur mit knöchernem Ausriss an der ventralen Tibiakante.
Normalbefunde an der Tibiakomponente (ap und laterale Projektion):
Normale Befunde an der Femurkomponente (laterale Projektion)
Normale Patellaposition
Implantatlockerung
Infektion
Typ I:
# undisloziert, Prothese intakt
Typ II: # disloziert, Prothese intakt
Typ III: # disloziert / nicht disloziert, Prothese
gelockert
Top mit
Inhaltsverzeichnis >> Knie >
Unterschenkel > OSG
und Rückfuß
I: Spaltbruch ohne Fehlstellung
II: Spaltbruch mit
inkongruenten
Gelenkflächen, 1 oder mehr Fragmente disloziert
III: Kompressionsfraktur mit Fehlstellung
der
gewichttragenden Segmente, Zertrümmerung
Tillaux-#
Eine Stufe von
> 2mm ist eine
OP-Indikation. Bei Jugendlichen entspricht dieser Typ der
Epiphysenfugen-# nach Salter-Harris II.
Epiphysen-# siehe oben, ## von A-Z.
3-Ebenen-# oder Marmor-Lynn-#, triplanare #.
Die # erstreckt
sich aus der
Epiphysenfuge heraus weiter in frontaler oder sagittaler Ebene zur
Kortikalis der Tibia.
Wagstaffe-LeFort-#
| medialer fibularer Ausriß am Ansatz des vorderentibio-fibularen Bandes. |
Maison-Neuve-#
Top mit
Inhaltsverzeichnis >>
Unterschenkel > OSG und Rückfuß
> Vor- und
Mittelfuß
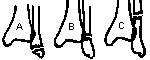
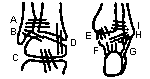 Bänder am OSG:
Bänder am OSG: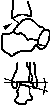 Bänderriß
auf gehaltenen und gedrückten Aufnahmen des OSG:
Bänderriß
auf gehaltenen und gedrückten Aufnahmen des OSG:
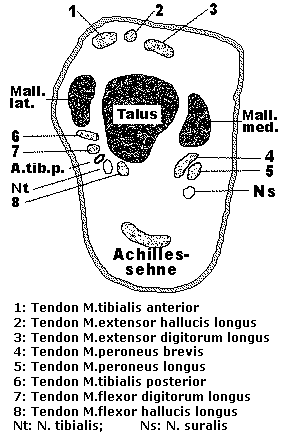
|
Top mit Inhaltsverzeichnis >> Unterschenkel > OSG und Rückfuß > Vor- und Mittelfuß |
Talus-#
nach Hawkins
Kalkaneus-#
Tuber-calcaneus-Winkel; Syn.: Böhlerscher
Winkel, Tuber-Gelenk-Winkel
Gelenkbeteiligungen bei Kalkaneus-# (nach Häufigkeit):
An Tibia, Fibula und
Kalkaneus Fusion
der Epiphysenfugen mit ca. 17 Jahren.
|
|
|
Top mit Inhaltsverzeichnis >> OSG und Rückfuß > Vor- und Mittelfuß > Schulter, proximaler Humerus und Schaft |
Talo-navikuäre
und
kalkaneo-kuboidale Luxation.
Metatarsale-1-#
Jones-#:
echte Jones-#: an der Basis des 5.MTS, max. 2,5 cm von der Basis entfernt (1), oft mit verzögerter Heilung und Pseudarthrosen verbunden.
Die falsche Jones-# ist ein Abriß an der Basis MT5 mit rascher Heilung.
|
Top mit Inhaltsverzeeichnis >> Vorfuß >Schulter, proximaler Humerus und Schaft >distaler Humerus, Ellbogen, proximaler Radius, Ulna, Radius- und Ulnaschaft |
ACG-Luxation nach Tossy / Rockwood:
|
|
A:
Körper-# |

Schulterluxation. Der Humeruskopf ist unter den unteren Rand des Glenoids eingekeilt. Der Rand des Glenoids hat in den Humeruskopf eine Kerbe geschlagen (Hill-Sachs-Defekt).
proximale
Humerus-#
subkapitale
Humerus-# in 2
Ebenen.
AO-Klassifikation proximale Humerus-# (AO 11) (ausführlichere AO-Klassifikation siehe www.jend.de)
Periprothetische
# bei
Humeruskopfprothese
University of Texas San Antonio Klassifikation
Top mit
Inhaltsverzeichnis >> Schulter, proximaler Humerus und Schaft >
distaler Humerus, Ellbogen, proximaler Radius, Ulna, Radius- und
Ulnaschaft > distaler Unterarm
1: hohe T-#, oberhalb der Fossa coronoidea
2: tiefe T-#, durch die Fossa coronoidea
3: Y-#
4: H-#
5: mediale Lambda-#, von medial suprakondylär nach lateral
infrakondylär plus vertikale transtrochleare #
6: laterale Lambda-#, von lateral suprakondylär nach medial
durch den Epikondylus medialis plus vertikale transtrochleare #
Essex-Lopresti-#:
(ALRUD: Akute
Longitudinale Radioulnare Dissoziation).
Monteggia-# (AO 22-A1.3)
Typ 4:
# der proximalen Ulna
und des Radius mit ventraler Radiusköpfchenluxation
Radius-# (mit Abwinklung nach volar) im distalen Drittel (gelegentlich bis ins Radiokarpalgelenk ziehend) mit dorso-ulnarer Ulnaluxation im Radioulnargelenk
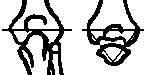
Radiusköpfchen-# (durch
Stauchung)
 A: Meissel-#
A: Meissel-# B: Impressions-#
C: Trümmer-#
|
|
nach
Judet: |

|
Top mit Inhaltsverzeichnis >> distaler Humerus, Ellbogen, proximaler Radius, Ulna, Radius- und Ulnaschaft > > distaler Unterarm > Handgelenk |
Distaler Unterarm
Distale Unterarm-#
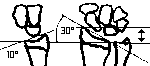 Radiuswinkel:
Radiuswinkel:10º volare und 30º (evtl. 15-25º) ulnare Kippung.
Höhendifferenz Radius/ Ulna (Doppelpfeil) 3-11 mm.
Hyperflexionstrauma: (Sturz auf Handrücken)
reversed
Barton-#:
volares Kantenfragment (intraartikulär)
|
Top mit Inhaltsverzeichnis >> distaler Unterarm > Handgelenk> Hand |
Handgelenk
Scaphoid-#-Klassifikation nach Russe:
Lunatum-# (1) oft unerkannt, kann sich zur Osteonekrose (Morbus Kienböck Stadien I-IV) entwickeln (4).
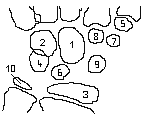
|
Top mit Inhaltsverzeichnis >> Handgelenk > Hand > The End |
 Bennett-#:
Bennett-#:
Abbruch
der ulnaren Gelenkfläche des Metakarpale I und radiale
Daumenluxation
Komplexe
Luxations-#: Bennet-#, Luxation MC II und III, Luxation Multangulare.
Y-förmige
Fraktur der Basis Metakarpale I ("Bennett-Trümmer-#")
Winterstein-#:
Vollständige
Querfraktur der Basis des Metakarpale I
|
Finis |
Haftungsausschluß lesen!
iSilo (Leseprogramm für den Handheld) und iSiloX (Konvertierungsprogramm für den PC oder Mac) beschaffen und einrichten.
Datei in iSilo-Konvertierungsfenster ziehen und konvertieren, oder nach Anweisung handeln. Dabei werden Text und verlinkte Bilder zu einer einzigen Datei zusammengefaßt.
Eigentumsrechte
Autor dieser Webseiten ist H.-H. Jend. Der Autor hat das Recht, diese Seiten jederzeit zu ändern , den Zugang zu beschränken oder sie vollständig zurückzuziehen.
Verwendung
Die Informationen auf diesen Seiten sind kein Ersatz für ärztliche Diagnostik, Beratung und Behandlung. Krankheit ist ein individuelles Geschehen das von dem Arzt oder der Ärztin des persönlichen Vertrauens behandelt werden muß.
Genauigkeit und Vollständigkeit
Obwohl die hier vorliegenden Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt wurde, wird für sie und für andere Informationen, die von diesen Seiten als Ausgangspunkt erreicht werden können, keinerlei Haftung für Qualität und Genauigkeit übernommen. Der Autor übernimmt keine Haftung für Fehler oder Mängel in den bereitgestellten Informationen oder für Folgen, die aus dem Gebrauch der hier vorliegenden Informationen resultieren. Der Autor bittet jeden Benutzer, etwaige Ungenauigkeiten oder Fehler mitzuteilen. Die Nennung von Warenzeichenzeichen, Handelsnahmen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß im Sinne der Warenzeichen- und Markengesetzgebung solche Namen als frei betrachtet und deshalb von jedermann benutzt werden dürften.
Copyright
Das Copyright liegt bei Dr. Hans-Holger Jend, sofern nicht im Einzelfall anders bezeichnet. Ohne schriftliche Genehmigung des Autors darf das Material nicht für den öffentlichen oder kommerziellen Gebrauch verändert, verteilt oder übertragen werden. Die Rechte an ihm überlassenen Material oder Texten, Daten, Software, Bildern bzw. anderen Informationen auf Papier oder anderen Datenträgern für diese Webseiten gehen auf den Autor über.
Haftungsausschluß
Der Benutzer hält den Autor von allen Schadensersatzansprüchen frei aus persönlichen Schäden, Forderungen und Belastungen aller Art die aus irgendeiner Verwendung dieser Webseiten entstehen oder entstehen könnten. Er haftet nicht für den Inhalt der hier genannten Links auf fremde Seiten.
Dr. Hans-Holger Jend
![]()